Pressestimmen
zur Mendelssohn CD Lieder ohne Worte - Teil II
 „Der Pianist Tilman Krämer scheint berufen zu sein, die verletzlichen Abstraktionsbilder der Mendelssohnschen „Lieder ohne Worte“ in großen, aber auch in kleinen lauschenden Atemzügen verantwortungsvoll abzubilden. Hier in dieser zweiten Folge dieser non- verbalen Musikvermächtnisse weiß er genau, dem Klavier die nötigen, die unvermeidlichen Farben abzugewinnen, ja mehr noch: er lässt das Instrument unter seinen Händen sprechen und singen. ... wichtig bleibt, wie er die leisen, die flüchtigen, die schwankenden, die wetterwendischen Töne, Klänge und Aromaten dieser wortlos beredten Stücke erfühlt und im wahrsten Sinne zum Besten gibt. ... Wer so betörend Mendelssohn ergründet, der sollte auch andere Klavierwelten mit bestem Erfolg durchmessen.
„Der Pianist Tilman Krämer scheint berufen zu sein, die verletzlichen Abstraktionsbilder der Mendelssohnschen „Lieder ohne Worte“ in großen, aber auch in kleinen lauschenden Atemzügen verantwortungsvoll abzubilden. Hier in dieser zweiten Folge dieser non- verbalen Musikvermächtnisse weiß er genau, dem Klavier die nötigen, die unvermeidlichen Farben abzugewinnen, ja mehr noch: er lässt das Instrument unter seinen Händen sprechen und singen. ... wichtig bleibt, wie er die leisen, die flüchtigen, die schwankenden, die wetterwendischen Töne, Klänge und Aromaten dieser wortlos beredten Stücke erfühlt und im wahrsten Sinne zum Besten gibt. ... Wer so betörend Mendelssohn ergründet, der sollte auch andere Klavierwelten mit bestem Erfolg durchmessen.Peter Cossé in „Klassik heute“, 10. 12. 2003
 „Die „Lieder ohne Worte“ ziehen sich wie ein roter Faden durch das Leben von Felix Mendelssohn. Sechs der insgesamt acht Hefte zu je sechs Stücken wurden noch zu Lebzeiten des Komponisten veröffentlicht, zwei Sammlungen erschienen posthum. Der Erfolg dieser Werke liegt in der großen Sensibilität, mit der Mendelssohn die Unmittelbarkeit des gesanglichen Moments auf das Klavier allein zu übertragen wusste. Die Vielfalt der lyrischen Stimmungen ohne Sentimentalität zum Tragen zu bringen, ist eine besondere Herausforderung an den Interpreten, vor allem dann, wenn er alle 48 Lieder spielt. Trotz der feinen kompositorischen Ausarbeitung der Stücke und ihrer expressiven Spannbreite, ist die Gefahr einer gewissen Eintönigkeit bei der Aufführung aller Lieder durchaus gegeben. Das Fehlen eines komplexen Gesamtzusammenhangs wie etwa in der Sonate ermüdet den Hörer, weil er sich immer wieder bei ähnlich formaler Gestaltung in einen neuen poetischen Ausdruck hineinfühlen muss.
„Die „Lieder ohne Worte“ ziehen sich wie ein roter Faden durch das Leben von Felix Mendelssohn. Sechs der insgesamt acht Hefte zu je sechs Stücken wurden noch zu Lebzeiten des Komponisten veröffentlicht, zwei Sammlungen erschienen posthum. Der Erfolg dieser Werke liegt in der großen Sensibilität, mit der Mendelssohn die Unmittelbarkeit des gesanglichen Moments auf das Klavier allein zu übertragen wusste. Die Vielfalt der lyrischen Stimmungen ohne Sentimentalität zum Tragen zu bringen, ist eine besondere Herausforderung an den Interpreten, vor allem dann, wenn er alle 48 Lieder spielt. Trotz der feinen kompositorischen Ausarbeitung der Stücke und ihrer expressiven Spannbreite, ist die Gefahr einer gewissen Eintönigkeit bei der Aufführung aller Lieder durchaus gegeben. Das Fehlen eines komplexen Gesamtzusammenhangs wie etwa in der Sonate ermüdet den Hörer, weil er sich immer wieder bei ähnlich formaler Gestaltung in einen neuen poetischen Ausdruck hineinfühlen muss.Tilman Krämer ist mit seiner Gesamteinspielung dieses Risiko eingegangen und hat es geschafft, dass man zwei Stunden jeder einzelnen Nummer gebannt zuhört. Er nimmt die Paradoxie der Lieder beim Wort, beginnt nämlich auf dem Klavier zu singen, artikuliert farbenreich abgestufte, melodiöse Bögen, baut von Stück zu Stück viele Stimmungen mit einem natürlich fließenden, stets unmittelbar wirkendem Ton so kunstvoll auf, dass ein Kompendium lyrischer Empfindungen jenseits biedermeierlich-salonhafter Tasten-Vermittlung entsteht. Jedes einzelne Lied erhält so die spontane Kraft eines poetischen Atemzuges, der wiederum ein weiteres Luftschöpfen in romantischer Atmosphäre nach sich zieht.“
Frank Siebert, „Fono Forum“, 6 / 2004
Interpretation * * * * *
Klang * * * *
 „ ...Tilman Krämer gestaltet jede einzelne der Miniaturen ganz individuell, arbeitet den Charakter fili-gran heraus und bringt sie so zum sprechen. Farbenreich artikuliert er die unterschiedlichen Klang-sphären und fesselt so seine Zuhörer. Auch in den temporeicheren „Liedern ohne Worte“ von Felix Mendelssohn Bartholdy lässt Tilman Krämer das Klavier singen und verwandelt diese Stücke zu wirklichen Liedern. Dabei schlägt er einen natürlich fast selbstverständlichen Ton an, der organisch aus seinen Fingern zu fließen scheint. Die Kompositionen bekommen so einen lebendigen Charakter, der eine romantische Klangwelt jenseits biedermeierlich anmutenden Haus- und Gelegenheitsmusik eröffnet.“
„ ...Tilman Krämer gestaltet jede einzelne der Miniaturen ganz individuell, arbeitet den Charakter fili-gran heraus und bringt sie so zum sprechen. Farbenreich artikuliert er die unterschiedlichen Klang-sphären und fesselt so seine Zuhörer. Auch in den temporeicheren „Liedern ohne Worte“ von Felix Mendelssohn Bartholdy lässt Tilman Krämer das Klavier singen und verwandelt diese Stücke zu wirklichen Liedern. Dabei schlägt er einen natürlich fast selbstverständlichen Ton an, der organisch aus seinen Fingern zu fließen scheint. Die Kompositionen bekommen so einen lebendigen Charakter, der eine romantische Klangwelt jenseits biedermeierlich anmutenden Haus- und Gelegenheitsmusik eröffnet.“Bettina Winkler, SWR Musik, „CD- Tipp“, 18. 6. 2004
 Viel(ver)sprechende Poesie
Viel(ver)sprechende PoesieSingend ein Gedicht vortragen, durch Musik sprechen – dazu diente schon immer am besten ein Lied. Ins Schleudern kommen Musikfreunde, wenn ein Komponist das Pferd von hinten aufzäumt und anstatt Poesie in Musik zu kleiden aus Musik Poesie macht. Lieder ohne Worte gab man im weitem Sinne schon im 18. Jahrhundert zum Besten, auch wenn Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) sie dann erst offiziell macht. Lieder ohne Worte gab man im weitem Sinne schon im 18. Jahrhundert zum Besten, auch wenn Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) sie dann erst offiziell als solche taufte. Dennoch ist man heute wie damals der Verlockung ausgesetzt, den innig-zarten bis gemütvoll-heiteren Klavierstücken einen wortreichen Odem einzuhauchen, um ihnen ein vermeintlich klareres Gesicht zu geben. Allzu sehr gegen Mendelssohns ästhetisches Credo indessen geht dieser Versuch, weil er den bestimmten Sinn der Noten mit unbestimmten Worten nur verdreht.
Vom Liedchen zum Lied
Dieser Versuchung vollkommen widerstehend in einer viel sagenden Interpretation und damit seinen schon ziemlich stabilen Sitz in der romantischen Klaviermusik festigend hat sich der junge Pianist Tilman Krämer den acht Bündeln aus je sechs Klavierstücken gewidmet und bei VENUS MUSIC eine hochwertige, beeindruckende Veröffentlichung vorgelegt. Dass einige Hefte davon meist ‚höheren Töchtern’ gewidmet waren, sie auch vornehmlich bei ihnen als beliebtes Salonrepertoire vorgeführt und lange Zeit als zwar hübsche, aber nicht wirklich ernst zu nehmende Liedchen abgetan wurden, ist dieser Musik bei Krämer nicht anzuhören. Mit verständiger Sorgfalt und bewundernswerter Reife zeigt er, wie wenig vieldeutig oder gar belanglos die ein- bis dreiminütigen Sätze sind. Ihm gelingt es, helle Wiederhörensfreude zu entfachen, wenn sich trotz fantasievoller, mannigfaltiger Kompositionseinfälle das ein oder andere Motiv irgendwann doch wiederholt. So etwa, wenn er gemäß eines venezianischen Gondolieres den wiegenden Wellen und gleichmäßigen Ruderbewegungen nachspürt und uns die Idee des italienreisenden Goethe vom Lauf des Lebens zu Ohren bringt; aber auch bei Stücken, deren Beinamen posthum aufgestempelt wurden, wie zum Beispiel beim Jägerlied’, dem Trauermarsch’ oder dem Frühlingslied’ entstehen un-aufdringliche, aber klare Bilder im hochromantischen Mendelssohnschen Malstil.
In der Ruhe liegt die Kraft
Buchstäblich spielend leicht’ mischen sich bei Krämer Melodie und Begleitstimme zu sinnlichen, geschmackvollen Klangfarben, wodurch sogar der leider etwas trockene, fast engräumige Aufnahme-Sound zu verschmerzen ist. Krämer hütet zudem das Geheimrezept dafür, ohne plakative Dynamikeffekte auszukommen und trotzdem die ganze Ausdruckspalette von sehr innig’ bis feurig’ zu artikulieren. Auffallend und gleichsam souverän ist, dass er die Lieder durchweg in ruhigeren Tempi nimmt als viele seiner Kollegen. Fast Geduldsfaden prüfend und Grenzen auslotend labt er sich genüsslich an musikalischen Phrasen, ohne dabei Fluss und Bogen zu bremsen. Mit Frische und vollem Respekt präsentiert er dem Hörer jede einzelne Miniatur, als hätte dieser großformatige Sonatensätze zu erwarten, und vermittelt das rosenselige Gefühl, alle Zeit der Welt zu haben, das Lied zu begreifen und sich ihm voll Muse hinzugeben. Dass es ihm dennoch nicht an jugendlicher Agilität und Virtuosität fehlt und er treffsicher in Windeseile über die Tasten zu fegen vermag, beweist er in dem akkordartig Wollfäden fabrizierenden Spinnerlied’ – jedoch immer seines Versprechens gewahr, den Zuhörer an der nächsten Ecke zu erwarten und wieder an die Hand zu nehmen.
Wortlose Empathie
Tilman Krämer wusste die Hefte zu einem kostbaren Liederbuch zu binden, mit dem er beispielsweise denen von Perahia oder Barenboim ohne Verrenkungen das Wasser reichen kann. Er beansprucht keinen Karriere fördernden Personenkult für sich und verzichtet in seiner Darbietung dennoch nicht auf Ecken und Kanten. Etwas verwundert muss man sich zuerst darüber klar werden, dass ihr Stoff nicht auf Worten in Gedichtform basiert, sondern lyrisch in Noten gesetzte Empfindungen eines sensiblen Künstlers des 19. Jahrhunderts sind. Krämer hat sie erspürt und teilt sie uns alle mit - und dies ganz und gar ohne Worte!"
Gabriele Pilhofer, „Klassik.com“, 4. 10. 2004
 „ [...] Gerade in den „Lieder ohne Worte“ scheint ja das „Lied“ immer wieder durch, und darüber hinaus lässt Mendelssohn Idiome wie den Trauermarsch (op. 62 Nr. 3) anklingen. Und doch: nichts erscheint als Zitat und alles wirkt echt, direkt, unmittelbar und in Schillers keineswegs abwertendem Sinne „naiv“. Dass dies gelingt, ist ein großer Verdienst des Pianisten Tilman Krämer, der sich in dieser zweiten Folge auf gefährliches Terrain begibt, sind doch unter den hier eingespielten Stücken immerhin so oft so böse ins salonhaft- schmachtfetzig verdrehte Opera wie das „Frühlingslied“ das „Spinnerlied“ oder das titellose Sequenzstück op. 67 Nr. 2. Bei Tilman Krämer hat man den Eindruck, dass er keineswegs Klippen umschiffen muß, um Mendelssohn durch und durch zu einer wohltuenden Frische zu verhelfen. Und trotz allem ist bei ihm die ganze Romantik da. Das Raunen, das Glitzern, das Singen, die Leidenschaft, die niemals zum reinen Pathos wird.
„ [...] Gerade in den „Lieder ohne Worte“ scheint ja das „Lied“ immer wieder durch, und darüber hinaus lässt Mendelssohn Idiome wie den Trauermarsch (op. 62 Nr. 3) anklingen. Und doch: nichts erscheint als Zitat und alles wirkt echt, direkt, unmittelbar und in Schillers keineswegs abwertendem Sinne „naiv“. Dass dies gelingt, ist ein großer Verdienst des Pianisten Tilman Krämer, der sich in dieser zweiten Folge auf gefährliches Terrain begibt, sind doch unter den hier eingespielten Stücken immerhin so oft so böse ins salonhaft- schmachtfetzig verdrehte Opera wie das „Frühlingslied“ das „Spinnerlied“ oder das titellose Sequenzstück op. 67 Nr. 2. Bei Tilman Krämer hat man den Eindruck, dass er keineswegs Klippen umschiffen muß, um Mendelssohn durch und durch zu einer wohltuenden Frische zu verhelfen. Und trotz allem ist bei ihm die ganze Romantik da. Das Raunen, das Glitzern, das Singen, die Leidenschaft, die niemals zum reinen Pathos wird.Oliver Buslau in „Piano News“ 1 / 2 2003
Brit Christiansen, "Stuttgarter Zeitung" vom 21. 1. 2004
 „ ... Der junge deutsche Pianist Tilmam Krämer gehört zu den wenigen, die Mendelssohns „Lieder ohne Worte“ nicht nur als hübsche Zugaben betrachten. In zwei Folgen hat er sämtliche 48 Stücke eingespielt- und diese Gesamtaufnahme wirkt keineswegs eintönig, sondern macht eher noch mehr Lust auf derart ernste Spielereien“
„ ... Der junge deutsche Pianist Tilmam Krämer gehört zu den wenigen, die Mendelssohns „Lieder ohne Worte“ nicht nur als hübsche Zugaben betrachten. In zwei Folgen hat er sämtliche 48 Stücke eingespielt- und diese Gesamtaufnahme wirkt keineswegs eintönig, sondern macht eher noch mehr Lust auf derart ernste Spielereien“Christiane Irrgang in „NDR Kultur Klassik Club Magazin“, Dez. 2003
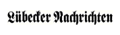 „ ... Krämer spielt diese Stücke so, wie man sie heute spielen muß: mit zurückhaltender Eleganz, Lockerheit und bei aller Expressivität durchsichtiger Stimmführung. So vermeidet Krämer die Gefahr des Kitsches — die nicht in den Kompositionen, sondern immer beim Interpreten liegt — und verhilft den „Lieder ohne Worte 2" zu der Würde, die ihnen zusteht. Denn in der Tat sind sie weit entfernt davon, bloß gefällige Salonstücke zu sein.
„ ... Krämer spielt diese Stücke so, wie man sie heute spielen muß: mit zurückhaltender Eleganz, Lockerheit und bei aller Expressivität durchsichtiger Stimmführung. So vermeidet Krämer die Gefahr des Kitsches — die nicht in den Kompositionen, sondern immer beim Interpreten liegt — und verhilft den „Lieder ohne Worte 2" zu der Würde, die ihnen zusteht. Denn in der Tat sind sie weit entfernt davon, bloß gefällige Salonstücke zu sein.Hanno Kabel in den „Lübecker Nachrichten“, 7. 11. 2003
